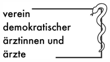Einführungsvortrag von Thomas Gebauer, medico international auf der Fachkonferenz „Abwehr oder Vorsorge? – Die G 20 und die globale Gesundheit
I.
Selbstverständlich ist es nicht falsch, wenn sich Gesundheitsminister/innen aus verschiedenen Teilen der Welt zusammensetzen, um gemeinsam über Verbesserungen zum Schutz der Gesundheit von Menschen nachzudenken.
Angesichts von Epidemien, die vor keiner Grenze haltmachen, angesichts des weltweiten Klimawandels, der auch und gerade die Gesundheit der Menschen beeinträchtigt, angesichts weltwirtschaftlicher Verhältnisse, die z.B. über bi- und multilaterale Handelsverträge vielfältigen Einfluss auch auf die nationalen Gesundheitswesen nehmen, steht wohl außer Frage, dass Gesundheitspolitik mehr denn je keine nationale Angelegenheit ist.
Die Erkenntnis aber, dass es in einer näher zusammengerückten Welt auch internationaler Bemühungen bedarf, um die Gesundheit der Menschen zu schützen, ist nicht eigentlich neu. Das war schon klar, als 1948, vor bald 70 Jahren, die Weltgesundheitsorganisation gegründet wurde. Mit großer Weitsicht heißt es in der Verfassung der WHO, dass eine „internationale Gesundheitsarbeit“ notwendig sei, die von einer zentralen Autorität gesteuert und koordiniert werden müsse: der WHO.
Ich betone das, weil mit Blick auf die zentrale Bedeutung der WHO ein Treffen, wie das der G20 Gesundheitsminister, durchaus nicht unproblematisch ist. Wir sollten nicht übersehen, dass es sich bei der G20 nicht um ein demokratisch legitimiertes und repräsentativ zusammengesetztes Gremium handelt, sondern eher um einen Club; einen exklusiven Club, um genauer zu sein, einen Club, in dem nur Mitglied werden kann, wer zu den führenden Wirtschaftsmächten zählt. Problematisch ist das nicht zuletzt deshalb, weil die Wirtschaftskraft eines Landes noch nichts über seine gesundheitspolitische Kompetenz aussagt. Mitunter ist es gerade das ökonomische Kalkül, das dem Recht auf Gesundheit, wie es in der Verfassung der WHO verankert ist, entgegensteht.
Trotz ihrer mangelnden Legitimation haben informelle Foren, wie die G7 oder die G20 in den zurückliegenden Jahrzehnten erheblichen Einfluss auch auf die Ausgestaltung der sozialpolitischen Verhältnisse und damit die Gesundheit der Menschen genommen; wir alle sind Zeuge geworden, wie im Zuge von Deregulierung und Austerität auch die öffentliche Daseinsvorsorge unter Druck geraten ist.
Aber noch ein weiteres ist zu beobachten. Deutlich wird im Zusammenhang der G7/G20 Treffen auch das, was in den politischen Wissenschaften mitunter als Ausdruck postdemokratischer Verhältnisse beschrieben wird: die zunehmende Verlagerung von politischer Gestaltungsmacht in die Hände weniger mächtiger Staaten. Und dort meist in die Hände technokratischer Expertenstäbe, die für das sorgen, was Jürgen Habermas als Kolonisierung menschlicher Lebenswelten bezeichnet hat: die zunehmende Unterwerfung von Mensch und Umwelt unter das Diktat von Ökonomie und politischer Kontrolle.
Das Bundesgesundheitsministerium, der Gastgeber des Treffens der Gesundheitsminister, scheint sich dieser Problematik durchaus bewusst zu sein. Immer wieder hat es betont, dass ihm vor allem an der Stärkung der WHO als einer unabhängigen zwischenstaatliche Organisation gelegen ist. Es wäre überaus hilfreich, wenn von dem Treffen der G20 Minister eine entsprechend Botschaft an die nächste Woche in Genf beginnende Weltgesundheitsversammlung ausgehen würde. Wir jedenfalls sollten den Ministern unsere Forderung nach Stärkung und Demokratisierung der WHO mit auf den Weg geben.
II.
Es sind große Fragen, die sich die Gesundheitsminister für ihr Treffen vorgenommen haben. Über den Aufbau globaler Notfallsysteme gegen Epidemien will man reden, über die Stärkung der Gesundheitssysteme ärmerer Länder und den Kampf gegen die zunehmende antimikrobielle Resistenz. Nur gemeinsam, so Hermann Gröhe, der deutsche Gesundheitsminister, könne man die Welt besser auf künftige Gesundheitsrisiken vorbereiten.
Das ist ohne Frage ebenso richtig, wie es auf einen zweiten Blick auch irritiert. Denn gibt nicht, wer sich auf künftige Risiken vorbereitet, bereits zu erkennen, dass sich Risiken nicht eigentlich mehr vermeiden lassen? Dass die große Idee der Moderne, man könne eine bessere Zukunft aufbauen, in dem die Risiken, denen Menschen ausgesetzt sind, aufgelöst bzw. reduziert werden, gescheitert ist? – Es lohnt sich, diesen Fragen zu stellen.
Schauen wir zunächst auf die gesundheitlichen Risiken, die schon heute zu beklagen sind und allerdings Anlass zur Sorge geben. Trotz des enormen Fortschritts, der in der Medizin erzielt wurde, sterben noch immer alljährlich Millionen von Menschen an Erkrankungen, die eigentlich gut behandelbar wären. Armutsbedingte Krankheiten wie die Tuberkulose, die im globalen Norden bereits überwunden schienen, kehren in dramatischer Form, als multiresistente Keime zurück; gleichzeitig breiten sich chronische nicht übertragbaren Krankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Störungen aus; nicht zuletzt in den Ländern des Südens ist deren Zahl stark angestiegen.
Verantwortlich für die heute in der Welt herrschende Gesundheitskrise ist sicherlich auch weiterhin die mangelnde Versorgung der Menschen mit Gesundheitsfürsorgemitteln. So hat noch immer fast ein Drittel der Weltbevölkerung keinen Zugang ausreichenden und sicheren Zugang zu essentiellen Arzneimittel. In vielen Teilen der Welt fehlen angemessen ausgestattete Hospitäler und qualifizierte Gesundheitsfachkräfte.
Die Krise aber geht tiefer; sie geht über den prekären Zustand, der in der Krankenversorgung herrscht, hinaus. So wichtig das Ziel einer universellen Absicherung im Krankheitsfalle ist, so sehr gilt es zu berücksichtigen, dass die gesundheitlichen Verbesserungen, die in den zurückliegenden Jahrzehnten, z.B. in Europa erzielt werden konnten, nur zu etwa einem Drittel dem medizinischen Fortschritt bzw. der verbesserten Krankenversorgung zu verdanken sind. Bedeutender als kurative Versorgungsangebote waren und sind gesellschaftliche Faktoren, wie der Zugang zu Einkommen, angemessene Wohnverhältnisse, würdige Arbeits- und intakte Umweltbedingungen, und nicht zuletzt Bildung und gute und ausreichende Ernährung.
Betrachten wir die Lebensumstände von Menschen im globalen Süden, dann entpuppen sich die dortigen Verhältnisse allerdings voller gesundheitlicher Risiken. Dort zeigt sich die Krise der Gesundheit eben nicht nur als Krise fehlender Versorgung, sondern zugleich als Krise der Ernährung, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse, der Umwelt, der Bildung, der sozialen Gerechtigkeit.
„Social injustice is killing people on large scale“. Soziale Ungleichheit tötet im großen Maßstab, heißt es zusammenfassend im 2008 vorgelegten Abschlussbericht der „WHO-Kommission über die sozialen Determinanten von Gesundheit“. Der Bericht lässt keinen Zweifel daran, dass sich die großen gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit nur über Eingriffe in die makroökonomischen und politischen Verhältnisse und nicht allein über medizinisch-technische Verbesserungen beantworten lassen. Nicht einzelne Krankheiten geißelt der WHO-Bericht, sondern die Pathologien der gesellschaftlichen Verhältnisse, genauso wie es Rudolf Virchow bereits Mitte des 19. Jahrhunderts getan hat.
Soziale Ungleichheit fällt nicht plötzlich vom Himmel. In den zurückliegenden Jahrzehnten konnte sie nur deshalb so dramatisch zunehmen, weil im Zuge der globalen Entfesselung des Kapitalismus (und um nichts anderes handelt es sich bei dem, was wir Globalisierung nennen), weil im Zuge dieser Globalisierung die Interessen einer wachstums- und profitorientierten Ökonomie über die Bedürfnisse und Rechtsansprüche der Menschen gestellt wurden. Daran haben nicht zuletzt Clubs, wie die G7 oder die G20 Anteil.
Das Wirtschaftswachstum, das mit der neoliberalen Globalisierung in Gang gesetzt wurde, hat die Ungleichheit nicht beseitigt, sondern verfestigt. Selbst das Davoser Weltwirtschaftsforum hat inzwischen einräumen müssen, dass mit der Globalisierung die Risiken für soziale Unsicherheit zugenommen haben.
Und diese Risiken bleiben heute nicht mehr nur auf die Armutsregionen der Welt beschränkt. Auch in den wohlhabenderen Ländern des Nordens nehmen die sozialen Gegensätze zu, auch hier geht die Schere zwischen arm und reich auseinander. Längst sind die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels, z.B. in der Zunahme von Atemwegserkrankungen, auch hierzulande spürbar, und längst macht die globale Schulden- und Finanzkrise mit all ihren Konsequenzen für die öffentliche Daseinsvorsorge auch vor Europa nicht mehr halt. Um die fatalen Folgen des Sozialabbaus zu studieren, muss man heute nicht mehr nach Afrika fahren: es reicht ein Trip nach Griechenland.
Ja, es sind große Risiken, die da auf uns zukommen, aber es sind nicht eigentlich neue Risiken; sie werden heute nur sehr viel deutlicher auch im eigenen Lande spürbar. Selbst der Umstand, dass der Zugang zu wirksamen Arzneimitteln versperrt sein könnte, ist ja nicht eigentlich neu. Für Millionen vom Menschen, die sich eine angemessene Behandlung mit Antibiotika aus Kostengründen nicht leisten konnten, ist das eine schon lange währende Realität. Nun kommt die Resistenzentwicklung hinzu, und die trifft auch die Reichen.
Und so sollten wir bei aller Sorge über die wachsenden Risiken nicht übersehen, dass diese noch immer extrem ungleich verteilt sind. Sie treffen die Armen und Mittelosen dieser Welt sehr viel stärker als die Wohlhabenden und Privilegierten. Mit dem Auftreten von Ebola ist nur klar geworden, dass die prekären Zustände, die in den armgehaltenen Ländern der Welt herrschen, auf den Rest der Welt auszustrahlen beginnen, – und es so für die Länder des Nordens schwieriger werden könnte, die eigenen Bevölkerungen zu schützen.
Es ist gut, dass Ebola als politischer Weckruf verfangen hat und nun verstärkt nach Lösungen gesucht wird; und es ist auch gut, dass Politikerinnen und Politiker in aller Welt erkannt haben, dass sie den Schutz der Gesundheit nicht länger den Marktkräften überlassen können, sondern sie selbst gefragt sind uns es höchste Zeit ist für regulierende Eingriffe und Maßnahmen systematischer Umverteilung ist. Ob die Wege, die nun eingeschlagen werden, auch die richtigen sind, das ist noch höchst fraglich.
III.
Denn die staatliche Sorge um Gesundheit kann viele Motive haben – gute wie schlechte. Sie kann dem universellen Menschenrecht auf Gesundheit verpflichtet sein, aber auch nur den Schutz der eigenen Bevölkerungen im Auge haben. Sie kann auf nachhaltige Vorsorge und Prävention drängen oder auch nur auf punktuelle Kontrolle und kurzfristiges Krisenmanagement aus sein. Sie kann das Ziel eines möglichst langen und möglichst gesunden Lebens für alle Menschen verfolgen oder auch nur den Interessen von Unternehmen dienen, die Gesundheit als ein höchst lukratives Business mit großem Wachstumspotential betrachten. Schon jetzt spekulieren Versicherungswirtschaft, Pharmaindustrie und medizintechnische Unternehmen auf die vielen Milliarden, die weltweit aus Steuermitteln zur Umsetzung von Universal Health Coverage bereitgestellt werden müssen.
Es ist dieses Spannungsfeld, in dem sich die Erörterungen der G20-Gesundheitsminister bewegen, und wir werden sehr genau zu beobachten haben, wohin die Reise geht.
Öffentliche Gesundheitsvorsorge jedenfalls ist nicht davor gefeit, für ökonomische und machtpolitische Interessen instrumentalisiert zu werden. Es ist noch gar nicht so lange her, da gehörte die Sorge um die Gesundheit der Menschen zu den Aufgaben örtlicher Polizeiverwaltungen. Im preußischen Deutschland etwa war das erklärte Ziel öffentlicher Gesundheitspflege nicht, für Langlebigkeit oder Wohlbefinden einzelner Individuen zu sorgen, als vielmehr die Leistungsfähigkeit der ganzen Bevölkerung zu sichern. Später kam die Sicherstellung von Wehrfähigkeit hinzu, schließlich die wahnhafte Idee einer nationalsozialistischen Rassenhygiene.
Letztere scheint zum Glück überwunden; das wirtschaftspolitische Motiv aber ist noch immer wirksam, zumindest latent. Wer genau hinsieht, kann es z.B. in vielen entwicklungspolitischen Studien entdecken, die zur Legitimierung von Gesundheitsförderprogrammen deren volkswirtschaftlichen Nutzen hervorheben. Oder in der Ausrichtung von Daseinsvorsorge an betriebswirtschaftliche Effizienzkriterien, um Kosten zu dämpfen, wie es dann heißt. Und selbst in der Bekämpfung von Pandemien taucht es wieder auf. So steht wohl außer Frage, dass die völkerrechtliche Verankerung der „Internationalen Gesundheitsvorschriften“, („International Health Regulations“) im Jahre 2005 ohne die vorangegangene Bedrohung des weltweiten Verkehrs von Gütern und Dienstleistungen, der Mobilität von Arbeitskräften, des Tourismus, durch SARS nicht bzw. nicht so schnell zustande kommen wäre.
IV.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht unproblematisch, wenn in den gesundheitspolitischen Debatten heute verstärkt ein Begriff auftaucht, der zwar in den internationalen Beziehungen schon seit längerem herumgeistert, im Kontext von „global health“ aber bislang weniger geläufig war: der Begriff der Sicherheit.
Die Ebola Krise, so heißt es, habe deutlich gemacht, wie dringend das Bemühen um Gesundheitssystemstärkung von Maßnahmen zur Förderung der „Health Security“, der Gesundheitssicherheit begleitet werden muss. Mitunter ist gar von der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels die Rede, von „global health security“ als einer neuen Norm, die allein dazu geeignet sei, all den bestehenden und künftigen Risiken Paroli zu bieten.
Das klingt zunächst einmal hoch verführerisch. Wer wäre in Zeiten wachsender Unsicherheit nicht für mehr Sicherheit? Angesichts einer zunehmend aus den Fugen geratenen Welt ist das Bedürfnis nach Sicherheit nur zu verständlich. Schauen wir aber genauer hin, wird die Sache komplizierter. Offen ist z.B. die Frage, was unter Sicherheit verstanden wird, wer Sicherheit definiert und wie sie geschaffen werden soll. All das ist unbestimmt und öffnet Tür und Tor für ganz unterschiedliche Strategien, in denen ganz verschiedene Interessen zum Ausdruck kommen können.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die skurril anmutenden Bilder von der Insel Rügen, als dort 2006 die Bundeswehr versuchte, zu Wasser, zu Lande und aus der Luft die Verbreitung des Vogelgrippevirus zu stoppen. Viele von uns haben damals geschmunzelt. Manche haben sich an längst überwunden geglaubte Formen einer kolonialen Seuchenmedizin erinnert, die mit einem „cordon sanitaire“ die Wohngebiete der Kolonialherren vor den compounds der „Eingeborenen“ zu schützen versuchte.
Doch dann kam 2014 die Ebola-Krise, und kam der Appell von MSF, Militär zu entsenden, um bei der Eindämmung der Seuche zu helfen. Ausgerechnet eine NGO, die ansonsten jede Nähe zum Militär weit von sich weist, verlangte nach Soldaten. Mit einem Mal ging es nicht mehr nur um zivile Hilfe, sondern um eine fast schon martialisch anmutende Form einer sicherheitspolitisch motivierten Intervention. Ebola schaffte es auf die Tagesordnung des UN-Sicherheitsrates, und zum ersten Mal in der Geschichte der UN wurde mit der UN Mission for Ebola Emergency Response (UNMEER) eine UN-Mission zur Bekämpfung einer Krankheit gebildet.
Seitdem diskutieren Experten in aller Welt über die Einrichtung von Notfonds, die Bildung von schnellen Eingreiftruppen, von Weißhelmen, die Schaffung robuster Versorgungsstrukturen und resilienten Gesundheitssystemen sowie die Notwendigkeit verbesserter Kommunikationswege. Um letztere einzuüben, werden die G20-Gesundheitsminister in den nächsten Tagen auch eine Art Manöver durchführen, in dem der Aufbruch einer Epidemie simuliert wird.
All das ist ohne Frage vernünftig; aber es ist eine nur instrumentelle Vernunft, die hier zum Ausdruck kommt. Eine Vernunft, welche mehr die Mittel, nicht aber die Ziele des Handelns reflektiert. Eine Vernunft, die nicht die Frage verfolgt, wie die Risiken an ihrem Ursprung zu bekämpfen wären, sondern wie mit künftigen Risiken so umzugehen ist, dass sie den Status quo nicht mehr bedrohen. Nicht ein radikales Bemühen um Krisenvermeidung steht auf der Tagesordnung, nicht eine Kritik an dem eigentlichen Treiber der globalen Gesundheitskrise, sondern die Frage, wie effiziente Krisenverwaltung möglich ist, ohne eben die Treiber der Krise angehen zu müssen.
So wie es aussieht, wird nicht die Marktradikalität mit all ihren negativen Auswirkungen auf die Lebensumstände und damit die Gesundheit der Menschen auf der Tagesordnung der Minister stehen, sondern nur, wie den offenbar alternativlos gesehenen Folgen der Marktradikalität: dem wachsenden Bevölkerungsdruck, der Migration, der Verslumung der Städte und dem Ausbruch von Epidemien an der Oberfläche begegnet werden kann. Nicht die Geschäfte der weltweit boomenden Extraktionswirtschaft, die immer mehr Menschen zur Abwanderung in unwirtliche und krankmachende Lebensumstände zwingt, stehen zur Debatte, sondern wie die daraus resultierenden gesundheitlichen Probleme möglichst früh identifiziert und eingedämmt werden können; nicht das längst notorisch gewordene Landgrabbing, der Trawler-Fischfang und die Praktiken der Nahrungsmittel- und Getränke-Multis, mit all ihren tiefgreifenden Auswirkungen auf die Ernährungssouveränität und die Ernährungsgewohnheiten von Menschen werden diskutiert werden, sondern wie es gelingt, für all die daraus resultierenden Krankheiten neue und wirksame Arzneimittel zu entwickeln.
Und eben das macht den herrschenden Sicherheitsdiskurs so problematisch. Es fragt weniger nach den Ursachen von Missständen, als danach, wie die krisenhaften Folgen von Fehlentwicklungen unter Kontrolle gebracht werden können. Statt über die Ländergrenzen hinweg auf sozialen Ausgleich und Integration zu drängen, setzt sicherheitspolitisch ausgerichtete Politik auf nachgelagertes Krisenmanagement. Der utopische Überschwang, der noch zur Gründung der WHO geführt hat, weicht so einem pragmatischen Realismus, der eigentlich nichts mehr verändern will, sondern nur noch darum bemüht ist, den Status quo, also bestehende Privilegien und die sie begründenden Machtverhältnisse abzusichern.
Besonders klar tritt uns diese Absicht heute in der Politik Donald Trumps entgegen. Stärker als es seine Vorgänger getan haben, betrachtet Trump die Bemühungen um globale Gesundheit vor allem aus dem Blickwinkel der nationalen Sicherheit. Die Reduzierung von Politik auf Gefahrenabwehr aber ist kein Phänomen, das auf die USA beschränkt wäre, es ist auch und gerade in den anderen G20 Staaten auszumachen.
Mit großen Ernst warnen kritische Wissenschaftler*innen und NGOs vor einer zunehmenden „Ver-Sicherheitlichung von Politik“; in der alles: der Handel, die Entwicklungshilfe, die Gesundheits- und Sozialpolitik ebenso wie die Polizei und das Militärs zu Instrumenten von Sicherheitspolitik werden. Problematisch ist die fast schon mythischer Überhöhung von Sicherheit vor allem deshalb, weil dabei das unter die Räder zu kommen droht, woran sich Politik eigentlich ausrichten sollte: das Recht und die Rechtsansprüche von Menschen, wie sie in den Menschenrechten niedergelegt sind.
Denn im Unterschied zu den Menschenrechten wird das Bemühen um Sicherheit nicht von der Idee der Universalität getragen. Wer von Sicherheit spricht, hat zuallererst die eigene Sicherheit im Blick, – eine Sicherheit, die an bestimmte Territorien oder Privilegien gebunden ist. Die gegenwärtigen sicherheitspolitischen Strategien zielen nicht unbedingt auf den Schutz (protection) derjenigen, die am meisten der sozialen Sicherung (Protection) bedürfen: die Armen und Mittelosen, sondern in aller Regel auf die Absicherung (security) von Besitzständen, auf die Sicherheit der Bessergestellten, genauer: auf die Absicherung jener imperialen Lebensweise, die einige auf Kosten anderer führen.
Aber da ist noch ein weiteres, das uns im Kontext des Sicherheitsdiskures zu denken geben sollte. Denn das, was als Bedrohung empfunden wird, ist immer subjektiv gefärbt, emotional hoch aufladen und vage. Und eben diese Unbestimmtheit hilft heutiger Politik bei der Überwindung ihrer Legitimationsdefizite. Politikerinnen und Politiker, die ihre gesellschaftliche Gestaltungskompetenz in hohem Maße den Vorgaben einer auf Deregulierung drängenden Ökonomie untergeordnet haben, können sich im „Zupacken“ bei der Abwehr der negativen Folgen dieser Ökonomie dennoch profilieren. Sie brauchen sozusagen die Krise, um sich gegenüber der Öffentlichkeit zu rechtfertigen.
Dieses absurde Zusammenspiel zu durchbrechen, wäre dringend nötig. Es setzt die Erkenntnis voraus, dass die Risiken, die künftigen wie die gegenwärtigen, nicht eigentlich von außen kommen, sondern von innen. Dass es die zunehmende Kolonisierung der menschlichen Lebenswelten ist, die die Welt zu einem so unsicheren Ort gemacht hat.
Statt in die Falle des Sicherheitsdiskurses zu laufen, sollten wir auf dem stärkeren Konzept der Menschenrechte bestehen. Denn Rechte sind im Gegensatz zum vieldeutigen Begriff der Sicherheit normativ kodifiziert. In ihnen lebt der Anspruch auf Gleichheit selbst dann noch, wenn Rechte durch Macht und Interessen gebeugt werden. Und so drängt die Anrufung der Menschenrechte auf eine Politik des Ausgleichs, die Logik von Sicherheit hingegen auf Abschottung. Kurz: Im Sicherheitsdispositiv geht das Prinzip der Universalität verloren.
V.
Schauen wir zum Abschluss auf mögliche Alternativen. Tatsächlich gibt es zu den Konzepten der Old Public Health, die, wie das Rolf Rosenbrock so treffend formuliert hat, „in der Logik der Gesundheitspolizei fragt: Wie ermitteln wir möglichst rasch viele individuellen Infektionsquellen und wie legen wir diese still?“, tatsächlich gibt es dazu Alternativen. Konzepte und Strategie, die einen ganz anderen Weg beschreiten. Die den Menschen nichts überstülpen wollen, die nicht mit Vorschriften auf Disziplinierungen sinnen, sondern auf Teilhabe und emanzipative Veränderungen im Sinne der Schaffung gesunder Lebenswelten zielen.
Ein solcher Ansatz, der der New Public Health verpflichtet ist, verlangt nicht nach robusten Versorgungsystemen, die notfalls auch mit martialischen Mitteln für das Stilllegen von Infektionsquelle sorgen, sondern gründet sich auf öffentliche Mobilisierung und zivilgesellschaftliche Partizipation. Denn das ist die Lehre, die aus allen zurückliegenden Erfahrungen auch und gerade in der Bekämpfungen von Epidemien zu ziehen ist: ohne eine maßgebliche Beteiligung von Selbsthilfegruppen, grassroot-Initiativen, kommunalen Selbstorganisationen, Kirchen und Wohlfahrtsorganisationen ist bestehenden gesundheitlichen Herausforderungen nicht zu begegnen. Welche Kraft im zivilgesellschaftlichen Engagement steckt, das wurde zuletzt noch einmal in der Bekämpfung von Ebola deutlich. Ohne die Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit, die von Selbsthilfegruppen vor Ort geleistet wurde, ohne die Einbeziehung der Betroffenen, die alleine in der Lage sind, in ihren jeweiligen Lebenswelten glaubwürdig aufzutreten, ohne das Engagement der Leute selbst wäre auch der Einsatz all der aus dem Ausland entsandten Helfer vergeblich gewesen.
Die Fragen, die sich New Public Health stellt, sind, um noch einmal den geschätzten Rolf Rosenbrock zu zitieren: Wie lassen sich möglichst schnell, möglichst bevölkerungsweit und möglichst zeitstabil gesellschaftliche Lernprozesse organisieren? Wie können Selbstverwaltungen und Entscheidungsteilhabe als Voraussetzung für nachhaltige Veränderungen gefördert werden? Wie die sozialbedingte Ungleichheit im Zugang zu Gesundheitschancen reduziert werden?
Klar ist, dass sich diese Fragen nur beantworten lassen, wenn auch die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Mittel werden gebraucht, um eine funktionierende allen zugängliche Krankenversorgung aufzubauen, keine Frage; sie werden aber auch gebraucht für die Förderung und Unterstützung von Initiativen, die auf Selbstverwaltung und Teilhabe drängen, und zwar dort, wo über Programme der Primärprävention, der Bildung, der Sozialhilfe, mithin über Maßnahmen, die allesamt im außermedizinischen Bereich liegen, konkret in die Lebenswelten von Menschen eingegriffen wird: in den Schulen, am Arbeitsplatz, in den Wohnviertel.
Dem Markt können diese Aufgabe nicht überlassen werden. Weil diejenigen, die am meisten auf Schutz und Unterstützung angewiesen sind, zumeist auch die Ärmsten sind, bedarf es gesellschaftlicher Institutionen, die allen, unabhängig von ihrer Kaufkraft, den Zugang zu Gesundheitschancen eröffnen. Es macht keinen Sinn, den Zugang zur Krankenversorgung an Versicherungspolicen zu knüpfen, die sich nur wenige leisten können. Allein eine solidarisch finanzierte öffentliche Daseinsvorsorge, die mit Blick auf den erreichten Globalisierungsgrad längst grenzüberschreitend zu schaffen wäre (was das heißt, darüber wird das letzten Panel diskutieren), kann dem Anspruch gleicher Gesundheitschancen gerecht werden. Ja, ist sind große Herausforderungen, vor denen wir stehen. Es ist höchste Zeit für die Stärkung von Gesundheitssystemen zu streiten, in denen die Schaffung von Institutionen einer öffentlichen Gesundheitspflege, die Finanzierung von Primärprävention und die Förderung von Selbstorganisation nicht nur ein Anhängsel von kurativer Versorgung sind, sondern wesentlicher Bestandteil.
Mit Blick auf die realen Mängel, die in vielen Teilen der Welt bestehen, mag ein solcher Ansatz utopisch klingen. Genau darum aber geht es: um die Formulierung einer Vision, die aus dem Elend herausführt und es nicht nur weiter verwaltet.
Vielen Dank.